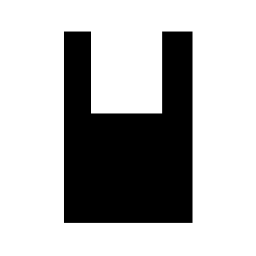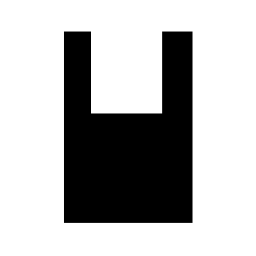Wer bei seinen Livegigs neben der Qualität der Bands auch Wert darauf legt, diese in möglichst großer Zahl zu sehen zu bekommen, der ist mit dem Huginns Awakening Festival im belgischen Oostende ausgesprochen gut bedient. Zwar verfügt das Event nur über eine einzige Bühne, auf der geht es dafür Schlag auf Schlag zur Sache. Und gerade richtig ist es: Viel mehr als elf Bands wird man sich an einem Tag realistisch betrachtet ohnehin nicht ansehen können oder wollen. Aus diesem Grunde, aber auch aufgrund des exquisiten Line-ups an sich begab sich auch der Crew-eigene Vielschreiber am gestrigen Samstag nach Flandern, übrigens zu seinem persönlich ersten ausländischen Festival – wer hätte das gedacht? (Daran, dass von der neuen Heimat aus die belgische Nordseeküste schneller zu erreichen ist als München, muss ich mich allerdings erst noch gewöhnen.)

Aufgrund einer überaus merkwürdigen Einlassroutine konnte dem Eröffnungsgig des Festivals, dargeboten von Violent Sin, leider nur ein Bruchteil der Leute beiwohnen, die um diese Uhrzeit eigentlich auf den Gelände sein wollten. Das ist insbesondere deshalb bedauerlich, weil die belgischen Speed-Youngster eine voll und ganz überzeugende Leistung ablieferten. Ihre gutklassige musikalische Darbietung rundete die Band mit einem engagierten Auftreten ab und schreckte selbst als Opener nicht vor dem Auffahren einer Pyroshow zurück. Das darf man einmal Ambition nennen!

Die folgenden Lethal Injury stellten die Lokalmatadoren des Events dar, stammen sie doch direkt aus Oostende selbst. Da das Festival an sich allerdings ja doch eine eher überregionale Angelegenheit mit einem sehr gemischten Publikum darstellt, war ich gespannt, wie groß der Heimvorteil sein würde, auf den die Band bauen könnte. Die Antwort? Nicht sehr groß. Die Stimmung fiel gegenüber Violent Sin deutlich merkbar ab, was gleich in mehrfacher Hinsicht verwunderlich ist: Zum einen waren inzwischen die meisten (allerdings immer noch nicht alle!) Zuschauer endlich auf das Gelände gelassen worden, zum anderen war auch mit der musikalischen Darbietung von Lethal Injury eigentlich überhaupt nichts verkehrt, es handelte sich um durchaus soliden Thrash Metal. Man wird also den Grund für die kühle Response auf den Auftritt nur an der Präsentation der Band selbst festmachen dürfen. Tatsächlich kultiviert Sänger Ivo Cardon nicht nur in seinem Aussehen, sondern auch in seinem Stageacting eher den mit dem Core-Genre assoziierten Aggro-Stil als den „good friendly violent fun“ des Thrash Metal. Auch wirkte die Band als Gesamtes streckenweise schlicht demotiviert und schien keinerlei Bock auf diesen Auftritt zu haben. Oder war vielleicht die negative Reaktion des Publikums zuerst da und die Lustlosigkeit der Musiker nur die Antwort darauf? Nun, eventuell handelt es sich auch einfach nur um eine Band, die eben auf Platte besser ist als live.

Es folgte mit Bütcher der letzte belgische Act des Tages, der die Stimmung wieder deutlich zu heben wusste. Der rüpelhafte Black Metal der Truppe kam hervorragend an und wurde mit einer stimmungsvollen Liveshow passend untermalt. Für die Band war der Gig insofern ein besonderer, als er die letzte Show mit Drummer LV Speedhämmer darstellte. Dieser kam kurz vor Schluss unerwartet gar noch zu einem Solo, als an der Gitarre zu technischen Störungen auftraten und die Wartezeit irgendwie überbrückt werden musste. Nebeneffekt dieser Unterbrechung war, dass zum Abschluss des Auftritts nicht, wie sonst üblich, „The Blakk Krusader“, sondern aufgrund der zeitlichen Verzögerung das kürzere „Speed Metal Attakk“ in derart wahnwitzigem Tempo heruntergeprügelt wurde, dass auch wirklich jeder vollständig bedient in die Umbaupause gehen konnte. Die Getränkestände hatten zu dieser Zeit Hochkonjunktur.

Die Schweden von Ambush habe ich ja bereits das eine oder andere Mal live gesehen und war immer sehr überzeugt. Dennoch konnte man den heutigen Auftritt durchaus als Härtetest betrachten. Zum einen war man als einziger Vertreter des Heavy Metal der mit Abstand softeste Act des Tages, zum anderen war Gitarrist und Charakterkopf Olof Enkvist auf Vaterschaftsurlaub zu Hause geblieben. Dass sich die Band trotzdem mühelos behaupten konnte und vom Publikum abgefeiert wurde, belegt in meinen Augen den Status von Ambush als erstklassige Liveband. Sessiongitarrist Alex Thunder ersetzte Olof absolut überzeugend, brachte seinen eigenen Stil ein und war dem originalen Gitarrero letztlich ebenbürtig. Die Güte der Liveshow der Skandinavier ist mittlerweile etabliert, dennoch bleiben Gigs der Gruppe stets interessant, da immer wieder neue Details eingefügt werden, um auch den passionierten Fan bei Laune zu halten. Diesmal wären hier beispielsweise die Widmung von „Heading East“ an die Ukrainer („Letʼs hunt some Russians!“), das kurze Basssolo vor „Hellbiter“ oder das Gitarren-Zitat von Accepts „Princess Of The Dawn“ am Start von „Natural Born Killers“ zu erwähnen.

Sehr gespannt war ich auch auf den Auftritt von Gama Bomb. An der musikalischen Klasse der Iren kann gar kein Zweifel bestehen, ihr Image als Spaßband dagegen lag mit der Gesamtausrichtung des Festivals einigermaßen deutlich über Kreuz und tatsächlich merkte man, wie in Anbetracht des Bühnenoutfits von Sänger Philly Byrne, bestehend aus einem pinken Ganzkörperanzug und neonblinkendem Mikrophonständer, zunächst eine Art bedröppelter Zurückhaltung durch das Publikum fuhr. Doch nichtsdestominder gelang es der Truppe, durch massive Einbindung der Zuschauer ihrer Situation Herr zu werden. Gegen Ende des Auftritts jedenfalls hatten die Herren die inzwischen recht gut gefüllte Halle voll im Griff – und, in aller Ehrlichkeit, wer, wenn nicht ein Philly, der von der Absperrung herab eigenhändig durstige Kehlen in den vorderen Reihen mit kühlendem Bier aus dem Bühnenbereich versorgt (Die Firma dankt!), hätte diesen Erfolg denn auch verdient gehabt?

Die Brasilianerinnen von Nervosa hatte ich zuletzt 2016 gesehen, zufälligerweise auch damals zusammen mit Destruction, und seinerzeit war mein Eindruck ein verhalten positiver, teilweise auch, weil ich mir im Vorfeld eher wenig von dem Gig erwartet hatte. Diesmal war es leider umgekehrt. Fast nur Songs vom neuen Album zu spielen, ist generell eine riskante Sache. Wenn aber jenes Album auch noch das schwächste der Bandgeschichte ist, schießt man sich mit einer solchen Wahl letztlich selbst ins Knie. Eine merkwürdige Entscheidung war es zudem, „Genocidal Command“ zwar zu spielen, aber nicht, wie auf der Albumversion, Schmier zum Duett auf die Bühne zu bitten, obwohl der mit eigener Band ja nachweislich auf dem Festival anwesend war. Kein schlechter Gig, aber mehr wäre definitiv möglich gewesen...

... So wie beispielsweise bei Angelus Apatrida. Die Spanier legten mit dem heutigen Gig den Auftakt für ihre Tournee durch Europa und Nordamerika, wirkten aber gemessen daran schon jetzt extrem abgeklärt und gut organisiert. Knapp 25 Jahre Bühnenerfahrung machen sich hier wohl einfach bemerkbar (unfassbar, wie lange die Anfänge des Thrash Metal-Revivals schon wieder zurückliegen!). Extrem schade war es lediglich, dass nach rund zwei Dritteln des Sets eine Dame im Publikum kollabierte, die zunächst notärztlich versorgt und dann in entsprechender Weise abtransportiert werden musste, was den Gig effektiv beendete.

Tja, und dann war es Zeit für die großen Jungs, endlich zu spielen. Den Anfang machten dabei Artillery, die aufgrund der Verzögerung von Angelus Apatrida nach einem ganz kurzen Line-Check so unvermittelt zu spielen begannen, dass ein Gutteil des Publikums noch überhaupt nicht darauf eingestellt war. Den nachfolgenden Gig gestaltete Dänemarks zweitgrößte Metalband nichtsdestoweniger sehr stark. Die Gitarrenfraktion spuckte ihre typischen komplexen und technischen Riffs und Band-"Youngster" Michael Bastholm Dahl (Gesang) sorgte für den Nahkontakt mit dem Publikum – letztlich, im Zuge einer Crowdsurfing-Session, sogar im ganz wortwörtlichen Sinne.

Es folgten mit Holy Moses eine derjenigen Bands, auf die sich der Verfasser dieses Berichtes vorab am meisten gefreut hatte. Die Aachener Thrash-Urgesteine um legendäre Frontfrau Sabina Classen, in meinen Augen nach wie vor die beste weibliche Sängerin des Metalgenres, befinden sich bekanntlich auf ihrem letzten Festivalsommer vor der Auflösung der Gruppe im Dezember und konnten die von Artillery gelieferte Vorlage sogar noch übertreffen. Sabina ist, gemessen an ihrem Alter, immer noch ausgesprochen agil und physisch präsent und wenn auch insbesondere bei den neuen Songs, die gerade im rechten Maße ins Set integriert wurden, der Text nicht immer ganz sicher zu sitzen scheint und der eine oder andere Gesangseinsatz mitunter mal einen halben Takt zu spät erfolgt, so kann man das doch keiner Frau übel nehmen, die anstelle eines Teleprompters ganz einfach ein analoges Buch mit auf die Bühne bringt und nach jeden Stück kurz umblättert – mehr Oldschool geht wohl nicht, wenn man gelegentliche Textwackler kaschieren will! Eine schöne Geste war es außerdem, zum abschließenden Dead Kennedys-Cover „Too Drunk To Fuck“ die Kolleginnen von Nervosa sowie einzelne Damen aus dem Publikum mit auf die Bühne zu rufen. Für den Rezensenten persönlich wurde der Gig zudem noch mit einer Setlist gekrönt!

Exciter waren für mich ein weiterer zentraler Grund, das Festival zu besuchen, hatte ich sie doch letzten Sommer noch so unglücklich durch Terminüberschneidungen verpasst, und tatsächlich konnten auch die Kanadier sämtliche Erwartungen mehr als erfüllen. Mir wäre spontan keine andere Band geläufig, die seit über vierzig Jahren im Geschäft ist und in ihrem Liveset trotzdem nur vier Jahre ihres musikalischen Schaffens abbildet. An irgendeinem Punkt in ihrer Karriere scheinen sich die Ahornblätter einig geworden zu sein, dass für sie einfach immer noch 1986 ist und dass alles, was nach diesem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, in ihren Setlisten keine Existenzberechtigung hat. Das mag für Vielfahrer, die die Band sehr oft besuchen, vermutlich irgendwann eintönig werden, für mich, der Exciter nun zum ersten Mal sah, war es dagegen großartig, all die alten Klassiker in der Vollbedienung zu bekommen. Überhaupt grenzt es ja an ein Wunder, wie es Dan Beehler mit über sechzig Jahren nach wie vor schafft, bei den Speed Metallern die Rollen des Drummers und des Sängers gleichzeitig zu übernehmen. Der Mann ist ein absolutes Phänomen und hat nebenbei noch die Energie, wie wild hinter seinem Drumkit tobend den ruhelosen Publikumsanheizer zu geben. Wahnsinn! Ein netter Twist war es überdies, dass die Band am Ende des Konzertes nach ihrem üblichen Closer „Long Live The Loud“ tatsächlich noch einmal auf die Bühne kam, um ein Cover von Motörheads „Iron Fist“ zum Besten zu geben. Ob das von vorneherein so geplant war, oder ob dem Trio nach dem Abgang von der Bühne schlicht aufgefallen ist, dass sie noch etwas Zeit übrig hatten, bleibt unklar, fest steht jedenfalls, dass man mit dieser Zugabe nicht unbedingt gerechnet hatte.

Abschließend kamen dann noch Destruction dran. Von den Süddeutschen weiß man natürlich von vorneherein, was man bei ihnen zu erwarten hat, auch wenn es für mich das erste Mal war, sie ohne Originalgitarrist Mike Sifringer zu sehen. Fazit: Konnte man auf Platte das Fehlen des zauseligen Saitengroßmeisters kompositorisch vielleicht hie und da erahnen, so macht sich sein Fehlen live kaum weiter bemerkbar. Ersatzmann Martin Furia darf, nicht zuletzt altersbedingt, im Zweifel gar als eine Ecke aktiver und agiler gelten als sein Vorgänger. Auch hinsichtlich der Setlist trafen Destruction das rechte Maß, banden die „Diabolical“-Scheibe stellenweise ein, legten den Fokus aber klar auf die Klassiker, um derentwillen die Besucher gekommen waren. So fügte sich also alles bestens zusammen bei den Badensern, die mit vergleichsweise opulenter Bühnenshow den würdigen Headliner für ein Huginns Awakening Festival darstellten, das von Zuschauerseite aus Betrachtet definitiv als voller Erfolg gelten kann.