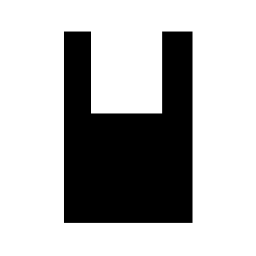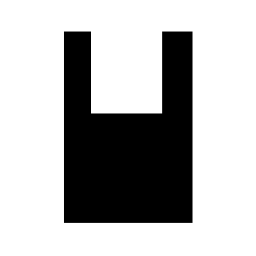Die Truppe habe ich vor X Jahren mal halbfreiwillig als Vorband gesehen. Könnte jetzt aber gar nicht mehr sagen, für wen eigentlich. Die konkrete Nummer hier fand ich allerdings damals schon seltsam. Ich meine, mal ehrlich - "Heile Heile Segen"? Was kommt als nächstes? Die Hardrock-Version von "Backe Backe Kuchen"?
Beiträge von Dr. Sin
-
-
"Nun geht es mit der Ausdehnung des Betrachtungszeitraumes im Traditional Thursday aber ein bisschen weit", höre ich den einen oder anderen Leser denken, wenn er die heutige Ausgabe betrachtet und, nachdem wir in der vergangenen Woche mit einer Nummer aus dem Jahr 1991 die Achtziger schon verlassen hatten, erfährt, dass der heutige Song des Tages erst 1993 der Öffentlichkeit zugänglich wurde. Dass dieser Gedanke allerdings vorschnell sein könnte, hoffe ich hier in wenigen Worten umreißen zu können.
Wenn hier die Rede von Poison ist, dann ist hoffentlich klar, dass es nicht um die Glam Metal-Poser aus den USA geht, sondern um die gleichnamige Gruppe aus dem schwäbischen Ulm. Dieses Quartett gründete sich bereits 1982 und brachte in den kommenden Jahren eine ganze Reihe von Demos auf den Markt, deren Aufnahmequalität allerdings in den meisten Fällen völlig unzureichend war. Erst 1987 veröffentlichte die Gruppe ihr vier Stücke umfassendes "Into The Abyss"-Tape, das, wie dem Großteil der Öffentlichkeit erst später bekannt wurde, in jeder Hinsicht einen Quantensprung darstellte und enormes Potential offenbarte. Noch in demselben Jahr durfte die Band einen der Songs von jener Demo, "Sphinx", auf dem von Roadrunner Records herausgegebenen "Teutonic Invasion Part One"-Sampler placieren. Diese insgesamt sehr empfehlenswerte Platte verfügte über acht Stücke, je eines pro Interpret, und legte stilistisch den Fokus auf das Thrash-Genre, wobei die herausragenden Vertreter auf der Scheibe Violent Force, Paradox, Minotaur und eben Poison waren. Erstere beide wurden dann auch tatsächlich von Roadrunner unter Vertrag genommen, während es Minotaur auf anderen Wegen letztlich zu einem Full-Length-Album brachten. Poison dagegen verhungerten, während sie vergeblich auf eine Rückmeldung des Plattenlabels warteten.
Erst Jahre später, eben 1993, gruben Midian Creations die "Into The Abyss"-Demo wieder aus und brachten sie doch noch als Vinyl in die Öffentlichkeit. Hierfür darf man dem Label durchaus dankbar sein, denn der Inhalt der Platte ist überaus eindrucksvoll. Trotz nur vierer Songs hat die Scheibe eine Laufzeit von über 32 Minuten, keine Nummer kommt unterhalb der Sieben-Minuten-Marke ins Ziel. Dabei ist die Musik allerdings nicht einmal sonderlich progressiv, sondern stellt sich als heftiges Death-Thrash-Gewitter dar, das selbst innerhalb der deutschen Thrash Metal-Szene der Achtziger zu den bösartigeren Outputs gezählt werden muss. Gruppen wie frühen Sodom oder Kreator standen Poison in Sachen Härte um nichts nach, agierten aber gleichzeitig auf einem, wenn auch nicht technisch, so doch kompositorisch viel ausgefeilteren Niveau. Sämtliche Nummern wechseln immer wieder das Tempo und werden zu keinem Zeitpunkt langweilig, lassen jedoch auch nie den Härtelevel fallen.
Ich habe einige Zeit überlegt, ob das massive "Slaves (Of The Crucifix)" oder "Sphinx" den besseren Song des Tages darstellen würde, doch letztlich erspare ich meiner Leserschaft ersteren Neuneinhalb-Minuten-Koloss und präsentiere mit letzterer Wahl den wohl bekanntesten Track der Band, der stellenweise mit leicht orientalischen Anleihen flirtet. Wann immer man Poison wieder auflegt, kann man es nur bedauern, dass diese Gruppe so schnell von der Bildfläche verschwunden ist. Es ist, alleinig basierend auf einer Demo, sicherlich eine gewagte Hypothese, aber ich könnte mir vorstellen, dass diesen Jungs der Sprung in die oberste Liga des deutschen Thrash Metal möglich gewesen wäre, wäre diese Scheibe nicht erst "posthum" 1993, sondern schon 1987 auf großer Breite veröffentlicht worden.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Furioser Freitag #203 - Teil2? Du willst den niedrigen Nummern wohl noch etwas erhalten bleiben?

-
Es geht einmal wieder hinauf in den hohen Norden an unserem Traditional Thursday, wenn wir nach längerer Zeit nochmal den zeitlichen Fokus dieser Kategorie nach hinten ein kleines bisschen bis ins Jahr 1991 erweitern und uns erneut den härteren Subgenres der Metal-Familie widmen. Spricht man von skandinavischem Death Metal, so denken die Meisten erfahrungsgemäß zunächst an den kommerziell höchst erfolgreichen Melo-Stil der Göteborger Schule. Ich habe in diesem Format bereits versucht, dieses Bild geradezurücken und darauf hinzuweisen, dass es durchaus auch starke nordeuropäische Bands gab, die eine wesentlich zupackendere Version dieses Genres verkörperten, und die schwedischen Sorcery fallen genau in diese Sparte.
Die Band gründete sich 1986 in Sandviken, rund 120 Kilometer nördlich von Uppsala, und veröffentlichte 1991 ihr erstes und bis zur Neugründung der Gruppe im Jahre 2009 einziges Album "Bloodchilling Tales". Treibende Kraft hinter der Formation waren Sänger Ola Malmström und Paul Johansson, der damals noch Schlagzeug spielte, in späteren Zeiten aber auf die Gitarre umstieg und Einigen vielleicht bekannt sein mag, weil er zwischenzeitlich einige Jahre bei In Aeternum Black-Death-Geprügel einspielte. Trotz dieses prominenten Namens und des Umstandes, dass auf dem Debutalbum noch Fredrik Nygren, später bei den Grindcorelern von Gadget tätig, die Gitarre bediente, ist die Musik auf "Bloodchilling Tales" nicht sonderlich komplex in dem Sinne, dass sie schwer zu spielen wäre. Das macht aber gar nichts, da die Band diesen Mangel an Technik auf anderem, insbesondere kompositorischem Gebiet kompensiert. Die Gruppe verfügt nämlich über ein hervorragendes Gespür für den richtigen Fluss eines Songs und wechselt mit Leichtigkeit zwischen schnellen und langsamen Abschnitten hin und her. Dazu kommt die Fähigkeit, jederzeit eine düstere, bedrohliche Atmosphäre heraufzubeschwören, welche die Horrorthematiken, welche die Lyrics der einzelnen Songs behandeln, perfekt untermalt. In diesem Sinne kommt das hier vorgestellte "Legacy In Blood" auf Platte eigentlich noch stärker als hier als Einzelsong, da es dort direkt hinter dem finsteren und lauernden Intro angesiedelt ist und der Durchschlagseffekt damit noch heftiger ausfällt. Was nehmen wir also mit aus der heutigen Ausgabe? Wer Death Metal liebt, der bleibt natürlich nicht bei diesem Song stehen, sondern gibt sich gleich die ganze Scheibe, das ist doch klar!
 Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Danke dir! Du weißt ja: Wann immer ich es zeitlich einrichten kann, gebe ich jederzeit gerne ungefragt meine Meinung zu allen möglichen Alben zu Protokoll

-
Review: Majesty - Back To Attack
Wie oft kommt es schon vor, dass man einen Review zu einer Band verfasst, die es gar nicht mehr gibt? Sicher, ein Gutteil der frühen Heroen unserer Szene bewegen sich so langsam auf das gehobene bis Greisen-Alter zu, doch geben ja die Meisten erfahrungsgemäß nach ihrem finalen Album zumindest noch eine Abschiedstournee, deren Besuch der Rezensent seinen Lesern dann noch einmal ans Herz legen kann. Nicht so bei Majesty: Veröffentlichung des neuen Studiowerks, eine Release-Show, zack, Schluss! Ein recht abruptes Ende nach vierundzwanzig Jahren Bandgeschichte, dessen Hintergründe man gerne genauer kennen würde - denn die ganze Art und Weise, wie die Auflösung kommuniziert wurde, erweckte nicht unbedingt den Eindruck, dass diese Entscheidung von langer Hand geplant war. Das alles soll allerdings in diesem Review nicht näher behandelt werden, vielleicht wird man ja zukünftig einmal mehr erfahren. Vielmehr soll es hier und heute um das elfte und letzte Studiowerk der Tauberfranken gehen, das unter dem Titel "Back To Attack" firmiert.
Aber handelt es sich denn auch tatsächlich um eine Rückkehr für das mitteldeutsche True Metal-Geschwader? Nun, eine Rückkehr aus der Covid-bedingten Untätigkeit liegt zweifelsfrei vor. Auch gibt das alte Bandlogo ein Comeback, nachdem es auf dem vermasselten Vorgänger "Legends" schon vermisst worden war. Die qualitative Rückkehr nach zwei sehr schlechten Studioalben gelingt Majesty dagegen nur teilweise. Dabei beginnt "Back To Attack" durchaus vielversprechend; der Titelsong ist eine Trueness-Hymne wie aus dem Lehrbuch, das düstere "Demon War" rockt nicht weniger stark und "Glorious Warriors" ist textlich zwar schon in grenzwertigem Maße plump, musikalisch aber ein grundsolider Midtempo-Stampfer.
Leider aber sind im weiteren Verlaufe nicht alle Nummern so überzeugend, nein mehr noch: "Back To Attack" verliert nach dem Anfangstrio komplett den Faden. Der einzige unter den verbliebenen sieben Tracks, der noch einmal an den Beginn der Scheibe denken lässt, ist das bedächtig schreitende "A Hero’s Storm". Viel zu oft aber verliert man sich in völlig drucklosen Kompositionen, wobei der Platte auch ihr Plastik-Sound alles andere als zuträglich ist. Das auf dieser Plattform kürzlich schon behandelte "Freedom Child" ist in dieser Hinsicht vielleicht ein besonders schlimmer, aber keineswegs der einzige Vertreter. Hört man einen Refrain wie den zu "Never Kneel", dann werden Gedanken an HammerFall in ihren käsigsten Momenten wach, keineswegs aber an die epischen Hymnen von Manowar (wobei deren Werke ja auch bereits des längeren zu wünschen übrig lassen, aber das ist ein anderes Thema...). Überzeugen kann lediglich noch das getragene "In The Silence", da sich hier die Kitschmelodien zumindest sinnvoll in die Gesamtstimmung der Nummer fügen.
Fazit:
Insgesamt aber bleibt bei "Back To Attack" ein fader Beigeschmack. Ja, die Scheibe ist besser als ihre beiden Vorgänger und man merkt der Band deutlich an, dass sie bemüht ist, nach den verirrten Experimenten der Vergangenheit wieder auf ihren bewährten Pfad zurückzukehren. Umso trauriger ist es aber eigentlich, zu sehen, wie mittelprächtig die Platte letztlich geworden ist. Das mag auch daran liegen, dass abseits des Bestrebens, kein "Legends 2.0" aufzunehmen, eine übergeordnete Gesamtausrichtung nur in Ansätzen zu erkennen ist. "Back To Attack" versucht, ein wenig von Allem zu sein, und ist am Ende von Allem zu wenig. Damit bleibt es, möchte man unter die Karriere von Majesty ein Fazit ziehen, bei nur einem echten Über-Kracher, der auf den Namen "Sword & Sorcery" hört, sowie drei weiteren Scheiben ("Keep It True", "MetalForce" und "Thunder Rider"), die vorbehaltslos empfohlen werden können. Sollte sich jemand trotzdem "Back To Attack" zulegen wollen - was, davon soll dieser Review kein zu negatives Bild zeichnen, zwar sicher nicht notwendig, aber für Fans des Genres jetzt auch nicht direkt ein Fehler ist -, dann empfiehlt sich allerdings auf jeden Fall die Vinyl-Version und zwar aus dem einfachen Grund, dass diese sich nach elf Songs abschaltet und daher mit "Our Time Has Come" auf einer leidlich positiven Note endet. Der CD-Bonustrack "Heralds Of The Storm" dagegen ist eine Gurke vor dem Herrn, die allenfalls noch von "Freedom Child" getoppt wird und mit jedem Recht eben genau ins Bonustrack-Nirvana verbannt wurde.ANSPIELTIPP:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Es ist eine Weile her, seit wir im Traditional Thursday zuletzt eine niederländische Band betrachtet haben, und deshalb begeben wir uns heute nach Zwolle, wo Anfang der Achtziger eine Band namens Godzilla ihre Tätigkeit aufnahm. Trotz des schon in Richtung Metal deutenden Namens war die Gruppe allerdings in diesem Genre noch überhaupt nicht tätig, sondern lieferte anscheinend eher mainstreamigen Poprock (ich selbst konnte online keinerlei Audiomaterial aus dieser Phase finden, um diese Info zu verifizieren; sollte jemand hier noch über mir unbekanntes Material verfügen, bin ich um jeden Hinweis dankbar!). Erst 1982 wandte man sich tatsächlich der harten Musik zu und änderte gleichzeitig den Bandnamen in Blackout.
Unter diesem Banner veröffentlichte man ein Jahr später eine durchaus hörenswerte Fünf-Song-Demo mit dem simplen Titel "Heavy Metal", mit der man es tatsächlich schaffte, die Aufmerksamkeit von Roadrunner Records auf sich zu ziehen. Mit diesem Label im Rücken war der Weg frei für eine Aufnahme in den renommierten Wisseloord Studios, wo später unter anderem noch Saxon ("Rock The Nations"), Iron Maiden ("Somewhere In Time"), Scorpions ("Crazy World"), Judas Priest ("Painkiller") oder Manowar ("The Lord Of Steel") Alben aufnahmen. Blackout schrieben also zusätzlich zu den fünf Demo-Songs noch dieselbe Anzahl Neukompositionen nieder und veröffentlichten das Ergebnis 1984 unter dem Titel "Evil Game". Die Scheibe bot hochklassigen, oft speedigen Heavy Metal mit einem gewissen Mitgeh-Faktor, aber auch immer einem guten Ohr für Melodien und ohne Abdriften in übermäßige härtetechnische Dimensionen; als stilistisch naheliegendster Vergleich dürfen die britischen Legenden von Motörhead gelten, wobei Sänger Bas van Sloten jedoch über eine deutlich cleanere Stimme verfügte als Lemmy Kilmister.
Leider war damit die Karriere von Blackout auch schon auf ihrem Höhepunkt angekommen, denn noch in demselben Jahre, in dem "Evil Games" veröffentlicht wurde, trennte sich die Band wieder. Einzelne Mitglieder waren jedoch später noch in anderen Projekten zu hören; zu nennen wäre hier der leider 2011 verstorbene Gitarrist Mannes van Oosten, der Anfang der 2000er zwei - allerdings ziemlich schwache - Alben mit To Elysium veröffentlichte, oder auch Bassist Alfred Kers, der ab 1985 Mitglied bei Stash war und es 2015 endlich geschafft hat, mit dieser Formation ein Debutalbum zu veröffentlichen - das darf man einmal Durchhaltevermögen nennen!
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ist auf jeden Fall eine interessante Band - mir fiele es jetzt auch nicht leicht, aus dem Stand eine einzige Band als Vergleich aus dem Hut zu zaubern. Das hier könnte man in meinen Augen am ehesten beschreiben als "Coroner meets Sepultura, aber mit dem Gesang von Helmet"

-
Review: Metallica - 72 Seasons
Es ist schon ein erstaunliches Phänomen, dass ausgerechnet die beiden mit Abstand größten Bands des Metal-Genres, Metallica und Iron Maiden, diejenigen Künstler sind, die von ihrer Fanbase, zumindest der ursprünglichen, am meisten kritisiert werden. Noch interessanter ist dabei, dass die Kritikpunkte sich im Falle beider Gruppen zumindest streckenweise erstaunlich ähneln. Beide haben sich längst weit von ihrem ursprünglichen Stil entfernt und können eigentlich kaum mehr guten Gewissens als die Speerspitze desjenigen Genres bezeichnet werden, in welchem sie groß geworden sind. Wer klassischen Heavy Metal liebt, der wird dieser Tage lieber bei Accept oder Judas Priest reinhören als bei Maiden, die unterdessen eher Progressive Metal spielen. Und was Metallica betrifft, so ist es bezeichnend, dass für sie mittlerweile der Vergleich mit Iron Maiden, der ausschließlich auf den Verkaufszahlen beider Gruppen basiert, häufiger gezogen wird als derjenige mit irgendeiner anderen Thrash Metal-Band - selbst derjenige mit den lange Zeit als Erzrivalen gehandelten Megadeth. Es würde auch, wenn man ehrlich ist, überhaupt keinen Sinn mehr machen, Metallica mit der Spitze der Thrash Metal-Bewegung zu vergleichen, da die Amis in den letzten Jahrzehnten bestenfalls ein bis zwei Handvoll Songs veröffentlicht haben, in denen wenigstens Reminiszenzen an jenes Genre zu finden sind.
Nun ist der neue Metallica-Longplayer "72 Seasons" draußen und auch er verändert wenig an dieser Gemengelage. Thrash Metal ist auf dem schwarz-gelben Scheibchen einmal mehr eine rare Mangelware, der Großteil des Albums dümpelt in eher zahnlosem Rock-Gewand vor sich hin. Sicher, auch in dieser Stilistik sind ein paar nette Ansätze auszumachen, aber es sagt schon etwas über die Gesamtqualität der Platte aus, wenn ein nettes, aber doch eher unbedeutendes Detail wie der kleine harmonische Twist im Riff zu "Chasing Light" am Ende als Highlight in Erinnerung bleibt. Der Titelsong wiederum startet zumindest mit einem coolen Thrash-Riff, reißt jedoch mit dem Hinterteil alles wieder ein, wenn sich der Beat ändert und auch diese Nummer zu einem zahmen Alternative Rock-Track verkommt. Allgemein sind die Stücke, an denen Kirk Hammett oder Robert Trujillo mitgeschrieben haben, im Durchschnitt noch schwächer als die reinen Hetfield-Ulrich-Kompositionen, bieten sie doch gemessen auf die Spielzeit noch weniger Höhepunkte.
Damit ist man freilich schon beim nächsten Punkt: Die Songs auf "72 Seasons" sind durch die Bank deutlich zu lang. Sicher, Metallica waren immer schon bekannt für eher üppige Instrumental-Abschnitte, doch waren diese auf ihren klassischen Alben sinnvoll strukturiert und zeigten irgendeine Form von Progression von einem Part zum nächsten. Auf der neuen Scheibe dagegen klingt Vieles einfach nach einer mitgeschnittenen Jamsession ohne jeden Spannungsbogen. Am negativsten macht sich das naheliegenderweise beim überlangen "Inamorata" bemerkbar, doch auch von den anderen Songs ist kaum einer vor diesem Makel gefeit. Die 77 Minuten Spielzeit der Scheibe hätte man locker um eine Viertelstunde entschlacken können, ohne dabei die Substanz irgendeines Stücks antasten zu müssen.
Es ist dann sicher kein Zufall, dass sich unter den vier kürzesten Songs der Platte auch die drei besten befinden. "Lux Æterna" ist ein flotter, stark NWoBHM-beeinflusster Heavy Metal-Feger mit hohem Energielevel. Etwas untypisch für Metallica, aber durchaus überzeugend. Das Problem ist lediglich, dass man sich, um überhaupt bis zu dieser Nummer zu kommen, erst einmal durch knapp 35 Minuten Material der Güteklasse "You Must Burn!" kämpfen muss. Nach "Lux Æterna" dauert es dann wiederum fast bis zum Ende des Albums, bis "72 Seasons" noch einmal irgendwie interessant wird. "Too Far Gone?" schlägt in eine ähnliche Kerbe wie der gerade genannte Track, ein weiteres klassisches Heavy Metal-Stück, ehe "Room Of Mirrors" tatsächlich noch mit gewissen thrashigen Anleihen aufwartet, wenngleich auch hier Melodie ganz klar groß geschrieben wird. Auffälligerweise sind es auch gerade die beiden letztgenannten Songs, die über die gelungensten Solo-Sektionen des gesamten Albums verfügen.
Ein weiterer Punkt sei hier nur noch angesprochen, weil er in anderen Rezensionen erstaunlich oft erwähnt wird. Vielfach wird nämlich dem musikalischen Mittelmaß von "72 Seasons" dessen angeblich hohe textliche Qualität gegenübergestellt. Noch nie habe, so liest man da, James sein Innerstes so vor dem Hörer ausgeschüttet wie auf diesem Longplayer. Mal ganz abgesehen davon, was es über ein Album aussagt, wenn man anstelle der Musik die Texte zu seiner Verteidigung ins Feld führen muss, scheint es sich bei derlei Aussagen um relativ unreflektierte Übernahmen aus den Pressetexten und Ankündigungen der Band selbst zu handeln. Ich jedenfalls konnte im Titelsong keine zwei Zeilen entdecken, die in irgendeinem erkennbaren inhaltlichen Zusammenhang miteinander stehen. Das ist kein intimer Einblick in die Seele des Dichters, sondern sinnentleertes Jonglieren mit Wörtern.
Fazit:
Um noch einmal auf den eingangs gezogenen Vergleich zu Iron Maiden zurückzukommen, so leiden Metallica weiterhin unter ähnlichen Symptomen wie ihre Genossen aus der alten Welt und man fragt sich, wie derlei auffällige Parallelen wohl zustande kommen. Glauben diese Bands, es aufgrund ihres enormen Erfolgs der Hörerschaft schuldig zu sein, immer gleich mindestens siebenzig Minuten Musik auf einmal abliefern zu müssen? Denken sie, dass es unter ihrem Anspruch wäre, einfach nur ein "normales" Album in ihrem angestammten Genre zu veröffentlichen, wie das auch unzählige andere Gruppen tun? Was immer es sein mag, fest steht, dass diese Herangehensweise die letzten Outputs beider Bands nicht besser gemacht hat. Nun ist die Lage bei Metallica immer noch nicht so dramatisch wie bei Iron Maiden, aber dennoch ist "72 Seasons" noch einmal deutlich spannungsärmer als "Hardwired... To Self-Destruct" und wäre ohne den Aufschwung gegen Ende qualitativ nicht über "Load" anzusiedeln. Die schwächste Metallica-Scheibe seit "St. Anger" ("Lulu" nicht mitgerechnet) ist es auch so.ANSPIELTIPP:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Mit der neuen Ausgabe des Traditional Thursday begeben wir uns einmal wieder nach Frankreich, genau genommen ins Elsass. Wie schon öfter erwähnt, sind unsere westlichen Nachbarn im Allgemeinen nicht eben als Bollwerk des klassischen Heavy Metal bekannt; um andere Subgenres hat sich die Grande Nation wesentlich mehr Verdienste erworben. Die Szene der Achtziger jedoch war nicht nur zahlenmäßig überschaubar, sondern auch qualitativ einem Großteil der internationalen Konkurrenz kaum gewachsen. Viele Bands versuchten sich an einer gewollt atmosphärischen Herangehensweise, ohne dabei aber über den unzweifelhaften Härtefaktor zu verfügen, der die Okkult-Meilensteine von Bands wie Mercyful Fate oder Angel Witch eben so effektiv machten.
Nichtsdestoweniger finden sich gerade, wenn man sich in den Underground dieser allgemein ja schon recht untergründigen Szene begibt, mitunter überraschend hochwertige Machwerke. Dies gilt auch für die Heavy Metaller von Auroch, denen die heutige Ausgabe gewidmet ist. Die Gruppe wurde 1983 durch Gitarrist Robert Defer gegründet, der bis zu seinem Tode 2019 allgemein recht umtriebig in der französischen Rock- und Metal-Szene war und zu dieser Zeit gerade die Prog-Rocker von Ange, seine vermutlich bekannteste Band, verlassen hatte. Er rekrutierte eine Reihe von weiteren Musikern, großteils aus anderen seiner Projekte, wobei eine gewisse Fluktuation von Anfang an gegeben war. Nichtsdestoweniger zeigten Auroch eine recht umfassende Live-Aktivität und brachten es zu Gigs im Vorprogramm von Vulcain sowie zu einem Auftritt im französischen Fernsehen. 1985 ging die Gruppe dann ins Studio, um für das Kleinstlabel Slim eine erste Aufnahme anzufertigen. Da das Geld allerdings nicht für das Recording eines vollständigen Albums reichte, beließ man es bei einer vier Songs umfassenden, viertelstündigen EP. Diese sollte freilich auch das einzige musikalische Zeugnis von Auroch bleiben, denn im Angesichte einer neuen Reihe von Umbesetzungen, im Zuge derer auch der charismatische Sänger der Formation, Regis Brival, dieselbe verließ, wurde die Band schließlich 1986 zu Grabe getragen. Das ist überaus bedauerlich, denn die selbstbetitelte EP zeigt eine Gruppe, die durchaus großes Potential gehabt hätte, wobei der Opener "Marginal" sogar die schwächste Nummer darstellt. Das treibende "Les Hordes Sauvages", das getragen-gefühlvolle "Songe" und der Rocker "Solitude" mit seinem leicht melancholischen Anstrich sind aber alle sehr hörenswert und machen das Scheibchen bis heute zu einem durchaus erinnernswerten Machwerk.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Review: Holy Moses - The Invisible Queen
Zugegeben, unsichtbar ist sie selbstredend nicht, die "Invisible Queen", wie sie auf dem Cover der neuen und letzten Holy Moses-Scheibe prangt, die letzten Freitag das Licht der Welt erblickte. Eher wirkt die gute Dame etwas eingestaubt und nicht mehr in allzu bestechender Verfassung, über und über mit Spinnweben behangen und sich mit der Linken an ihrem Stab, mit der Rechten am Thron festhaltend. Sollte Sabina Classen damit eine Selbstreferenz angestrebt haben (der Refrain des Titelsongs lässt mit der Zeile "I am the invisible queen" diesen Schluss zumindest zu), so ist es keine allzu schmeichelhafte solche. Tatsächlich muss man sich aber - so viel sei direkt vorweggenommen - keine Sorgen machen, Holy Moses seien im Verfall begriffen oder von Altersschwäche übermannt worden. Gesanglich macht Sabina jedenfalls immer noch eher dem dreiköpfigen Hund (seinerseits eine nette Anspielung auf die Bandhistorie) Ehre als der maroden Monarchin.Und auch insgesamt ist "Invisible Queen", soweit man bei dieser Band und ihrer über vier Dekaden umspannenden Karriere von einem einheitlichen Stil sprechen kann, ein typisches Holy Moses-Album geworden, wobei die Vorabveröffentlichungen nicht einmal unbedingt die größten Höhepunkte darstellen. So sind der Titelsong und "Alternative Reality" eher unauffällige Nummern im Gesamtgefüge. Dass die Band freilich trotz der bekannten allgemeinen Stilistik nicht vorhat, sich auf eine reine Retro-Schiene festlegen zu lassen, zeigen schon die ersten Tracks deutlich. Der Opener "Downfall Of Mankind" ist ein überraschend melodischer Thrasher mit, für Holy Moses-Verhältnisse, raumgreifenden Instrumentalparts, den man so in der Banddiskographie bestenfalls noch auf "The New Machine Of Liechtenstein" hätte platzieren können. Beinahe als Antithese dazu fungiert das tollwütige "Cult Of The Machine", das an die brutalsten Tage der Gruppe anknüpft, ehe "Order Out Of Chaos" mit eskalierender Doublebass und Gangshouts tatsächlich die erwartbaren "Finished With The Dogs"-Erinnerungen wachruft.
Der jüngeren Bandgeschichte entstammen dagegen die sich windenden, spiralförmig steigenden und fallenden Gitarrenläufe von Peter Geltat, die immer dann Raum greifen, wenn das Tempo einmal etwas herausgenommen wird. Auch die Produktion ist zeitgemäß und vergleichsweise luftig, vergleichbar am ehesten mit "Agony Of Death", allerdings ohne dessen modernistische Kinkerlitzchen. Das weiß im Grundsatze zu gefallen, verabschiedet man damit doch zumindest in Teilen die sehr nivellierende Produktion, die "Redefined Mayhem" streckenweise zu einer eher trockenen Angelegenheit machte. Vereinzelt finden sich auf "Invisible Queen" auch Nummern, wo das Songwriting selbst an das Spätwerk von Holy Moses angelehnt ist; das abschließende "Through The Veils Of Sleep" wäre so ein Fall. Weitere Highlights inkludieren "Visions In Red" mit stellenweisem Black Metal-Einschlag, das kurze und intensive "Outcasts" und "Depersonalized", das mit einem sehr melodischen Gitarrensolo für einen Überraschungsmoment sorgt.
Fazit:
Ist die neue Holy Moses-Scheibe so stark wie ihre Werke der Achtziger? Nein. Ist das der einzige Maßstab, an dem man "Invisible Queen" messen darf? Ebenso nein. Holy Moses - das gilt es zu betonen, denn das ist die eigentlich wichtige Erkenntnis - verabschieden sich mit einem würdigen Output, der Fans des Genres zweifelsohne zufriedenstellen wird. Auch im direkten Vergleich mit den letzten Longplayern zeigt sich die Gruppe auf der neuen Scheibe verbessert und liefert mit ihrem finalen Werk auch gleichzeitig ihr bestes seit "Strength Power Will Passion", vielleicht sogar seit "Reborn Dogs", ab. Naheliegenderweise wird das hier Dargebotene das Genre nicht revolutionieren, aber nichtsdestoweniger ist es unterhaltsam, es ist fein gespielt und komponiert und es ist vor allem hochgradig intensiv - mit anderen Worten: Alles, was ein Thrash Metal-Album sein sollte!Abschließend soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass es von der neuen Scheibe auch eine "Invisible Friends" betitelte Sonderfassung gibt, auf der befreundete Musiker der Band die Songs von "Invisible Queen" reinterpretieren - für Die-Hard-Fans und Komplettisten sicher eine lohnenswerte Ergänzung!
ANSPIELTIPP:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Kaum ist ihr neues Album herausgekommen, machen die Thrash-Urgesteine von Overkill auch schon europäische Lande unsicher und beehren auf ihrer Scorching The Earth-Tour auch die bayerische Landeshauptstadt mit ihrer Anwesenheit. Mit dabei hat man zwei weitere amerikanische Oldschool-Acts, die das Line-up sehr schön abrunden. Zunächst aber wurden die Kroaten von Keops auf die Bühne geschickt. Die gaben sich auch alle Mühe, das Publikum auf Touren zu bringen, unter musikalischen Gesichtspunkten bleibt aber unklar, was die Veranstalter dazu bewogen hat, diese Gruppe an den Anfang eines Thrash Metal-Abends zu stellen, und so fielen denn auch die Reaktionen eher verhalten aus. Eine gute Idee war es da, dass die Band kurz vor Schluss noch ein Cover von "Symphony Of Destruction" auspackte.
Trotzdem: Der Quantensprung war in jeder Hinsicht gewaltig, als Heathen die Bühne betraten. Auf ihrer Headliner-Tour hatte ich die Technical Thrasher letztes Jahr an allen denkbaren Daten ärgerlicherweise nicht besuchen können und tatsächlich bereue ich das nach diesem Auftritt noch mehr als zuvor! Die Bay Area-Vertreter, bei denen Kyle Edissi (Gitarre) und Ryan Idris (Drums) die verhinderten Lee Altus und Jim DeMaria vertraten, hatten das Publikum von der ersten Note an voll im Griff und lieferten einen phantastischen Gig ab. Leider war in der Setlist das sehr starke 2020er Album "Empire Of The Blind" nicht mehr so präsent, wie es noch vergangenes Jahr der Fall gewesen war, doch bot dafür die Songauswahl die echten Highlights aller vier Longplayer der Band nebst dem unerwarteten The Sweet-Cover "Set Me Free", das aber völlig überraschend überzeugen konnte! Der einzige Makel dieses Gigs war, dass er als zweiter Act des Abends natürlich viel zu kurz war, denn Heathen waren die eigentlichen Gewinner dieser Münchener Frühlingsnacht.
Eingeklemmt zwischen dieser übermächtigen Vorlage und dem Headliner, um dessentwillen ja eigentlich alle gekommen waren, konnten Exhorder, bei denen Waldemar Sorychta den aktuell vakanten Posten an der Leadgitarre ausfüllte, eigentlich nur untergehen. Ihr Gig war nicht schlecht und wurde auch angemessen goutiert, doch dass die Stimmung nicht solche Höhepunkte erreichte wie bei ihren Gefährten von der Westküste, konnte nicht nur den technischen Problemen am Bass und dem kurzfristigen Zerfall von Teilen des Drumkits angelastet werden.
Overkill wiederum griffen die Zuneigung des Publikums souverain auf und lieferten ihrerseits einen starken Gig ab, wenngleich die Setlist nicht völlig makellos erschien. Dabei geht es weniger um das mittelmäßige, aber tatsächlich nur sehr dezent bespielte neue Album "Scorched"; vielmehr hatten sich Overkill eine ganze Reihe von Überraschungen ausgedacht, von denen aber nur manche wirklich aufgingen. Während beispielsweise der namensgebende Song "Overkill" voll einschlug, kann ich nicht behaupten, dass mir Tracks wie "Coma" oder "Long Time Dyin’" in einem Overkill-Set bisher immer gefehlt hätten. Diese Einlagen führten vor allem in der Mitte des Gigs zu gewissen Längen, was zwar der Stimmung keinen Abbruch tat, aber bei einer Band mit einem so respekteinflößenden Backkatalog und derart vielen Hits wie Overkill eigentlich nicht sein müsste. Dennoch zelebrierten die fünf Herren aus New Jersey einen gewohnt starken Auftritt und präsentierten sich vielleicht sogar ein bisschen besser gelaunt als vor vier Jahren, als ich sie zuletzt in Nürnberg sah. So wird dann wohl jeder Thrasher am Ende des Abends mit guter Laune und dem legendären Cover von "Fuck You" von The Subhumans im Ohr nach Hause gegangen sein - und das ist ja am Ende, was eigentlich zählt!
-
Review: Scorched
Es ist noch gar nicht so lange her, da stellte eine aus New Jersey stammende Achtziger-Jahre-Institution mit dem grünen Bandlogo wohl weltweit das Maß aller Dinge in Sachen Thrash Metal dar. Die Rede ist selbstredend von den Urgesteinen von Overkill, die während der ersten Hälfte der zehner Jahre die Szene dominierten. Mit "Ironbound" meldete sich das Quintett nach einem langen und steinigen Weg aus der Krise, in die die Band in den Neunzigern geschlittert war, eindrucksvoll zurück und die Nachfolger "The Electric Age" und "White Devil Armory" können mit Recht als moderne Klassiker gelten. Demgegenüber stellte "The Grinding Wheel" ein recht durchwachsenes Scheibchen dar, ehe man 2019 mit "The Wings Of War" wieder Boden gutmachen konnte. Der neueste Streich, insgesamt Nummer zwanzig in der Bandgeschichte, hört nun auf den Namen "Scorched" und hätte eigentlich schon 2021 veröffentlicht werden sollen, wenn nicht die Pandemie das unmöglich gemacht hätte. Nach zwei Jahren der Verzögerung und des Anlegens von letztem Schliff an die zehn Nummern steht nunmehr die längste Pause, die je zwischen zwei Overkill-Alben lag, zu Buche und umso gespannter ist die Szene natürlich, wie sich die neue Scheibe einordnen lässt.Nun, für den Thrasher dürfte "Scorched" kein ganz einfaches Album werden, denn wirklich abgehen tut es hier nur in seltenen Fällen. Man verstehe das nicht falsch: Selbstverständlich darf man Overkill nicht an den Maßstäben messen, die man an eine typische Bay Area-Band oder gar die deutschen oder südamerikanischen Genrevertreter anlegen würde, denn die Ostküstler haben sich niemals so sehr auf pure Geschwindigkeit und rohes Geknüppel verlassen wie die Genannten. Doch wenn auf einer Platte von zehn Songs über die Hälfte davon kaum in die Gänge kommen, dann ist das bei einem Thrash Metal-Album schlichtweg zu beanstanden. Noch schwerer wiegt dieser Makel, wenn auch das Songwriting an sich verhältnismäßig bieder ausfällt. Overkill sind eine Band, die eigentlich auf jedem ihrer Alben (vom in sich tatsächlich sehr konsistenten "White Devil Armory" vielleicht einmal abgesehen) die eine oder andere schwächere Nummer dabeihatte, doch waren sie oftmals in der Lage, dies zu kompensieren, indem sie einen absoluten Über-Hammer auf ihrer Scheibe platzierten. Diese Fähigkeit scheint Songwriter D.D. Verni jedoch in letzter Zeit ein wenig abhanden gekommen zu sein. Schon "The Wings Of War" hatte mit "Believe In The Fight" (das die Band in ihrer Live-Setlist ironischerweise komplett ignorierte) nur einen einzigen Track an Bord, den man mit viel gutem Willen zu den Karrierehighlights der Gruppe zählen konnte, und auf "Scorched" suche ich einen solchen Mega-Hit bisher gänzlich vergebens. Die Probe auf’s Exempel lässt sich schon ganz zu Beginn der Scheibe machen: Wenn der Titelsong auch gleichzeitig der Opener ist und zudem noch als Single ausgekoppelt wird, dann möchte man meinen, es hier mit dem zentralen Track des Albums zu tun zu haben. Tatsächlich ist "Scorched" auch eine gute Nummer, vielleicht die beste des ganzen Longplayers, und für manch andere Band würde solch ein Stück einen wahren Höhepunkt markieren. Aber im Falle von Overkill wird man sich leider dennoch schwer tun, unter den Openern der letzten fünf Alben irgendeinen zu finden, der "Scorched" nicht deutlich vorzuziehen wäre.
Damit ist natürlich leider auch schon angesprochen, dass die Scheibe nach dem Opener nicht wirklich besser wird. Im Gegenteil, nur noch bei zwei Songs, "The Surgeon" und "Harder They Fall", wird ein ähnliches Energielevel erreicht wie hier. Diese Zahmheit großer Teile der Platte mag zum Teil mit der musikalischen Leistung der einzelnen Mitglieder zusammenhängen. Zumindest bei Bobby Blitz scheint sich das Alter mittlerweile bemerkbar zu machen, Ausflüge in höchste Stimmlagen sind auf "Scorched" die große Ausnahme. Stattdessen versucht sich Bobby häufiger an melodiösen Gesangslinien, gerne unterstützt von dezenten Harmony Vocals, was ihm jedoch nicht wirklich gut zu Gesichte steht. Daneben muss sich auch Dave Linsk die Kritik gefallen lassen, dass er es, bei aller völlig unbestrittenen technischen Klasse, nicht immer geschafft hat, wirklich interessante Gitarrensoli zu schreiben. Immerhin, Sticks Bittner scheint eine Art Kreativitätstrank gefunden zu haben, jedenfalls ist der Drummer ständig aktiv und unterhält den Hörer über die fünfzig Minuten des Albums hinweg prächtig, weit über die Standards des Genres hinaus.
Zum Anderen mag jene gewisse Beliebigkeit, die "Scorched" anhaftet, vielleicht auch mit der langen Entwicklungsphase des Albums zusammenhängen. Möglicherweise hatten Overkill einfach zu viel Zeit, Dinge auszuprobieren, den experimentiert wird auf der neuen Scheibe zur Genüge - es sei der altbekannte (und leider seit jeher heillos überbewertete) Doom-Thrash auf "Fever", die epischen Elemente in "Twist Of The Wick" oder der betont entspannte Rock von "Bag o’ Bones", dessen Refrain sich anhört, als hätten ihn Megadeth während der "Youthanasia"-Sessions aussortiert. Hätten Overkill diese Experimente, wie es ja ihrem üblichen Veröffentlichungsrhythmus entspräche, auf zwei Alben aufgeteilt und damit die Innovation pro Longplayer gerechnet halbiert, hätte dies dem Endergebnis vermutlich gut getan. So wirkt "Scorched" leider Gottes ein wenig zerfahren.
Fazit:
Es dürfte aus dem oben Geschriebenen deutlich geworden sein, dass die neue Scheibe keineswegs mit den Knallern, die die Band bis 2014 veröffentlichte, konkurrieren kann, und auch im Vergleich zum direkten Vorgänger "The Wings Of War" mangelt es "Scorched" einfach an Energie. Als Vergleichsobjekt kommt damit in der jüngeren Vergangenheit der Banddiskographie nur "The Grinding Wheel" in Betracht. Fest steht, dass der durchschnittliche Song auf dem 2017er Album noch etwas langatmiger und zäher war als auf der aktuellen Scheibe. Andererseits verfügte jenes Album mit "Mean, Green, Killing Machine" über einen echten Über-Hit und mit "Our Finest Hour" und "Let’s All Go To Hades" zusätzlich noch über zwei weitere Nummern, die auf "Scorched" schwerlich Ihresgleichen finden werden. Müsste ich gerade im Moment eine Wahl treffen, so würde ich wahrscheinlich trotzdem "Scorched" den knappen Vorzug geben, da gerade der hohe Abwechslungsreichtum auch für einen gewissen Unterhaltungsfaktor sorgt, selbst wenn nicht jede Nummer ins Schwarze trifft. Trotzdem handelt es sich sicherlich um eine der schwächeren Overkill-Scheiben der jüngeren Vergangenheit und man darf gespannt sein, ob es der Band gelingen wird, mit dem nächsten Studio-Output wieder etwas konziser zu Werke zu gehen. Sollte nicht wieder eine Pandemie dazwischenkommen, dürfte dieser wohl gegen 2025 zu erwarten sein.ANSPIELTIPP:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ostern ist vorbei, aber für den Thrash Metal-Fan kommt der eigentliche Feiertag doch erst morgen; neue Alben von Metallica, Overkill und Holy Moses - alle auf einmal! Was für ein Thrash-Fest! Nun, zugegeben, die Erwartungen hinsichtlich des Thrash-Anteils der einzelnen Alben divergieren doch recht deutlich und so ist auch die Vorfreude unterschiedlich stark ausgeprägt; beim hiesigen Schreiberling ist die Begeisterung bezüglich Holy Moses unzweifelhaft am größten - nicht zuletzt deshalb, weil es sich bei "The Invisible Queen" bekanntlich um das Abschiedsalbum der Kulttruppe handelt und man da natürlich noch einmal besondere Erwartungen hegt. Deshalb werden heute, quasi zur Einstimmung, Sabina Classen und ihre Jungs einmal wieder in unseren Songs des Tages gefeatured.
Sabina hat in einem Interview kürzlich zu Protokoll gegeben, dass Holy Moses sich nie wiederholt hätten und jedes Album der Band seinen eigenen Charakter besitze, und wenn man die Diskographie der Gruppe einmal durchgeht, so bestätigt sich diese bei den meisten Musikern als reine Floskel zu verstehende Aussage in erstaunlichem Maße. Das Debut, "Queen Of Siam" war zwar schon ein einwandfreies Thrash-Album, wies aber in seinem lärmigen, etwas unkoordinierten Vorgehen noch starke Ähnlichkeiten zu Venom auf. "Finished With The Dogs" war ein Jahr später schon rein härtemäßig ein anderes Kaliber und schoss einfach alles in Stücke. Daraufhin erhielten die Aachener einen Plattenvertrag bei WEA; das folgende "The New Machine Of Liechtenstein" war so nah am Mainstream, wie Holy Moses in ihrer Karriere je kommen würden. Stellenweise konnte man Parallelen zu Metallica entdecken, wenngleich Sabina immer noch alles in Grund und Boden blökte, was dem kommerziellen Erfolg vermutlich abträglich, dem Trueness-Faktor aber enorm dienlich war. Anno 1990 ging "World Chaos" beinahe ein Stück zu weit in Richtung Punk, wenngleich der Titeltrack vermutlich den besten Einzelsong von Holy Moses darstellt und auch "Jungle Of Lies" amtlich Ärsche tritt. In den folgenden zwei Jahren folgten mit dem düsteren "Terminal Terror" und dem wahnwitzigen "Reborn Dogs" zwei extrem bösartige Bastarde, die streckenweise in Richtung Death Metal tendierten und von der Allgemeinheit vollkommen zu Unrecht ignoriert wurden. Danach stieg Sabina zwischenzeitlich aus und in der Folge konnte die Band nie mehr an ihre alte Klasse anknüpfen, weshalb wir unseren Durchgang durch die Banddiskographie an dieser Stelle abbrechen, doch dürfte deutlich geworden sein, wie Holy Moses, obwohl sie doch im Großen und Ganzen immer dem Thrash Metal treu geblieben sind, tatsächlich im Laufe ihrer Karriere sehr unterschiedliche Facetten ihres Sounds erproben konnten, ohne dass sie jemals gezwungen oder verkrampft nach Innovation um jeden Preis geklungen hätten. Daran könnten sich einige, vor allem jüngere Gruppen ein gutes Beispiel nehmen!
Als Song des Tages hätte ich eigentlich gerne etwas von meinen heimlichen Lieblingen "Terminal Terror" oder "Reborn Dogs" vorgestellt, doch in Anbetracht der aktuellen Situation muss dieses Vorhaben vertagt werden. Denn bevor morgen die "Invisible Queen" als letzter Output der Bandgeschichte auf die Menschheit losgelassen wird, gibt es nur einen Song, der als Einstimmung richtig gewählt ist. Das ist der Titeltrack des Debutalbums, "Queen Of Siam" - quasi "Holy Moses: Wie alles begann". Es wird spannend sein, zu sehen, ob die Gruppe mit ihrem neuen Album (immerhin dem ersten seit neun Jahren) noch einmal an diese alte Stärke anknüpfen kann!
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Habe grade mal nachgeschaut - damit sind die scheinbar erstmals hier im Kotzer vertreten... In diesem Sinne: Es wurde höchste Zeit!

-
Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Empfindung alleine stehe oder ob es meinen Admin-Kollegen auf dieser Seite ähnlich ergeht, doch wenngleich man, während man so im Laufe der Jahre seine Songs des Tages schreibt, eine ganze Menge Bands vorstellt, gibt es zumindest bei mir immer so einen Rest an Gruppen, die man eigentlich immer schon einmal behandeln wollte, es aber letztlich nie getan hat. Häufig handelt es sich dabei gerade um Formationen, die einem besonders am Herzen liegen. Um diese Bands zu behandeln, will man natürlich auf den richtigen Moment warten und sie nicht einfach an irgendeinem X-beliebigen Donnerstag verbraten. Zudem will man sie auch in einer Ausgabe vorstellen, wo man etwas Zeit und Muße zum Schreiben hat und nicht nur, wie es leider viel zu oft vorkommt, zwischen diversen Terminen gerade noch Möglichkeit hat, in ein paar Minuten einige Zeilen zu verfassen. Und so wartet man dann auf den perfekten Zeitpunkt, der aber natürlich nie kommt. Genau daran liegt es, dass Holy Terror, obwohl ich sie ungelogen schon seit mehreren Jahren in meiner Shortlist habe, noch nie in einem Song des Tages behandelt wurden. Doch heute ist es endlich so weit. Wir feiern die zweihundertste Jubiläums-Ausgabe des Traditional Thursday, die zudem gerade auf die letzte Woche vor Ostern fällt - eine bessere Gelegenheit wird sich so schnell wohl nicht ergeben!
Für diejenigen, die im Speed Metal-Genre vielleicht weniger beheimatet sind, seien also Holy Terror in aller Kürze vorgestellt. Gründer und Kopf der 1985 entstandenen Gruppe war Gitarrist Kurt Kilfelt, der zuvor einem sehr frühen Line-up von Agent Steel angehört hatte, diese jedoch nach dem, ebenfalls 1985 erschienenen, Debutalbum "Skeptics Apocalypse" wieder verlassen hatte. Schnell tat sich Kurt mit seinem Mittäter an der Gitarre, Mike Alvord, sowie dem Bassisten Floyd Flanary zusammen. Anfänglich war außerdem Jack Schwartz dabei, der 1985 noch auf dem Dark Angel-Debut "We Have Arrived" das Drumkit verprügelt hatte, ehe er bei den Thrashern ausstieg und - die Geschichte ist bekannt - dem jungen Gene Hoglan Platz machte. Als Sänger war bei Holy Terror Keith Deen von der Partie, der, wenn auch kein technisches Genie im klassischen Sinne, mit seinem Stil doch die beiden Alben, die die Band 1987 und 1988 veröffentlichte, prägte. Zu dieser Zeit war Jack allerdings schon nicht mehr dabei, da er, ohne die anderen Bandmitglieder zu informieren, einen Plattenvertrag mit Music For Nations abgeschlossen hatte. Die Folge war sein (nicht ganz gewaltfreier) Rauswurf, weshalb auf beiden Platten der Band Joe Mitchell am Schlagzeug zu hören ist. Die angesprochenen Scheiben können beide als sträflich unterbewertete Zeugnisse des US-Metals Ende der Achtziger gelten. Das Debut, "Terror And Submission", bot technisch herausragend gespielten Speed Metal mit filigranen Melodien, die doch nicht den durchaus beträchtlichen Härtegrad verwässerten. Der Zweitling, das noch einen Ticken stärkere "Mind Wars", orientierte sich im Vergleich dazu etwas mehr in Richtung Thrash Metal und bot sogar noch eine Spur mehr Zug.
Natürlich schlugen die beiden Alben beim anvisierten Publikum ein und die Gruppe tourte beinahe ununterbrochen. Auf der Amerikatour zu "Mind Wars" musste freilich Kurt wegen technischer Probleme etwa dreißig Shows aussetzen, was in der Band zu Streitigkeiten führte. Das Ende der Formation jedoch kam auf der folgenden Europatour mit Exodus und Nuclear Assault, als Keith bei einem Konzert in Deutschland in betrunkenem Zustande verkündete, man habe einen Plattenvertrag mit Roadrunner Records abgeschlossen (ob es sich dabei um die Wahrheit handelte oder nicht, konnte ich bislang noch nicht in Erfahrung bringen). Dies brachte das, von Holy Terror ohnehin ungeliebte, Music For Nations-Label dazu, die Band schlicht von der Tour zu streichen, und als die Musiker sich kurzerhand Equipment von Kreator liehen, um auf dem nächsten Gig dennoch aufzutreten, kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Somit in überaus missliche Lage geraten, gab kurz darauf Mike auf und verließ die Band. Das verbliebene Quartett lebte noch zwei Wochen lang in ihrem Tourbbus in München und eine weitere in einem Hotelzimmer, ehe man auf Kosten von Kurts Freundin (um welche selbiger sich übrigens Jahre zuvor beinahe eine Schlägerei mit Dave Mustaine geliefert hätte) nach Hause flog.
Holy Terror aber waren am Ende und auch ein Reunion-Versuch Mitte der Nuller-Jahre blieb ohne Erfolg. 2012 starb schließlich Keith, womit die Chancen auf neues Material wohl endgültig bei null liegen. In den letzten zehn Jahren hat sich Mike mit drei italienischen Musikern zusammengetan, um eine Gruppe namens Mindwars zu gründen, die exzessiv auf Mikes Vergangenheit bei Holy Terror Bezug nehmen, eigentlich aber wenig Berechtigung haben, irgendwie als legitime Nachfolger zu gelten.
Ich habe lange überlegt, welchen Stück aus Holy Terrors bewegtem Werdegang ich hier als Song des Tages führen soll, und mich letztlich für "No Resurrection" vom "Mind Wars"-Album entschieden, welches die Tugenden der Band stark repräsentiert. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß mit dem Soundtrack zum Jubiläums-Thursday!
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Review: Lordi - Screem Writers Guild
Als Lordi-Fan hatte man es nicht unbedingt leicht in letzter Zeit; die Alben der Finnen genügten schon seit Jahren selbst Mindesterwartungen nurmehr gelegentlich und den Vogel schoss vor zwei Jahren die "Lordiversity"-Sonderbox ab, in der die Band dem verdutzten Zuhörer den gesamten Ramsch der kompositorischen Mottenkiste, der es sonst aus gutem Grunde nie auf ein Album geschafft hätte, nonacharlant vor die Füße schüttete. Nach dieser Episode war dann der Plattenvertrag ebenso futsch wie der Gitarrist und nicht Wenige mögen Lordi schon abgeschrieben haben, doch nun sind die finnischen Monster zurück und legen mit "Screem Writers Guild" ihr neues Studioalbum vor. Die Scheibe macht schon allein durch das coole Artwork Einiges her und die Ankündigung des Obermonsters, dass es sich zwar (wie sollte es anders sein) um ein Album mit Referenz zu diversen Horrorfilmen, nicht aber um ein Konzeptalbum handeln solle, weckte durchaus eine gewisse Vorfreude und so lautet die große Frage nun: Wird mit "Screem Writers Guild" endlich alles gut?
Die Antwort ist ein klares: Jein. Wie zu erwarten war, stellt "Screem Writers Guild" ein deutlich angenehmeres Hörerlebnis dar als das "Lordiversity"-Fiasko. Insbesondere scheint sich die Hereinnahme von Gitarrist Kone bezahlt gemacht zu haben. Trotz des nur mittelmäßig kreativen Bühnencharakters, den der Neue verkörpert, und obwohl es wohl viele Lordi-Fans immer noch schmerzen wird, mit Amen den neben dem Obermonster letzten Teil der klassischen (ESC-)Besetzung verloren zu haben, kommt man nicht umhin, festzustellen, dass der Zugang gerade die Soli der Band auf ein neues Niveau zu heben vermag. Auf "Screem Writers Guild" darf er sich dahingehend freilich nur bei einzelnen Songs ausleben, hier wäre noch mehr Potential vorhanden gewesen. Auch als Songwriter bringt sich Kone recht eifrig ein und schlägt auf dem neuen Album mit drei Kompositionen zu Buche. Zum Vergleich: Schlagzeuger Mana verzeichnet einen, Keyboarderin Hella und Bassist Hiisi diesmal überhaupt keinen Songwriting-Credit.
Hier liegt allerdings auch schon ein Teil des Problems, denn die von den Instrumentalisten mitkomponierten Songs erweisen sich durchwegs als die Highlights des Albums, was im Umkehrschluss bedeutet, dass das, was das Obermonster alleine an Liedern fabriziert hat, die Hoffnungen nur in Ausnahmefällen erfüllen kann. So stehen dann neben coolen Nummern wie "Dead Again Jayne", "Inhumanoid" oder "Lucyfer Prime Evil" Schnarcher der Marke "Thing In The Cage", "Vampyro Fang Club" oder "Lycantropical Island", bei denen man im Refrain den Eindruck gewinnt, man höre ABBA mit schlechterem Gesang. (Eigentlich wäre in dieser Liste auch "Unliving Picture Show" zu nennen, wobei hier weniger der Refrain als das Keyboard im Hauptpart das Ärgernis darstellt.)
Ein weniger schwerwiegender, aber nichtsdestominder verwunderlicher Aspekt fällt schon auf, wenn man die Scheibe startet und nicht, wie früher gewohnt, von einem "SCG"-Intro begrüßt wird. Stattdessen hat man sich entschieden, das Intro, das übrigens nett gemacht ist und an die allererste Lordi-Scheibe erinnert, einfach zum Teil des Openers "Dead Again Jayne" zu erklären. An sich ist das gar kein Problem, doch wenn dann der Hörer im weiteren Verlaufe des Albums nicht von einem, sondern von noch zwei (!) zusätzlichen "SCG"-Installationen beglückt wird, muss man sich schon fragen, ob es mit den Interludien nicht ein bisschen viel des Guten ist - zumal gerade Nummer zwei doch arg albern ausfällt. Umso mehr ist man als Rezipient erleichtert, dass der ominös betitelte Closer "End Credits" nicht noch ein weiteres Hörspiel darstellt, sondern sich als sehr gefühlvolle, getragene Nummer entpuppt. Damit ergibt sich eine gewisse Symmetrie insoweit, als beide Seiten der Scheibe (wenn wir von der LP-Fassung ausgehen) mit einer Ballade enden, und tatsächlich zählen beide Stücke zu den besseren des Longplayers. Das unprätentiöse "The Bride", geschrieben aus der Sicht von Frankensteins Monster, einer der wahrhaft tragischen Figuren des Horrorkinos, überzeugt mit einer Sangesleistung, die man dem Bandchef nicht unbedingt zugetraut hätte, und "End Credits" stellt gar zum Abschluss nochmal ein kleines Highlight dar.
Fazit:
Quo vadis, Lordi? Diese Frage lässt sich nach der Veröffentlichung von "Screem Writers Guild" tatsächlich nur unwesentlich besser beantworten als im Vorfeld des Releases. Die neue Scheibe hat genug Klasse, um nicht als Enttäuschung zu gelten, aber von einer Rückkehr zu alter Stärke kann, wenn man einmal ehrlich mit sich selbst ist, auch keine Rede sein. Das ist schade, da das Grundkonzept (man könnte auch sagen "Die Anlage") des Albums jede Menge Potential gehabt hätte, genau einen solchen Kracher abzuliefern. Doch dafür ist das Songmaterial einfach über weite Strecken nicht zwingend genug und gerade beim Obermonster hat man das Gefühl, als sei ein wenig die Luft raus. Anthalerero, lange Zeit Admin des deutschen Lordi-Webforums und bestens mit der Band vertraut, beendet den Review der Scheibe im Stormbringer-Webzine leicht konsterniert mit den Worten "Recht viel besser wird’s wohl nicht mehr". Dem könnte man sich zweifellos anschließen. Man könnte allerdings auch das halbvolle Glas sehen und konstatieren "Recht viel besser waren sie schon seit ‚Scare Force one‘ nicht mehr" - ob das nun mehr über die neue Scheibe aussagt oder über den Werdegang von Lordi in den letzten zehn Jahren, davon mag sich jeder Leser selbst ein Bild machen.ANSPIELTIPP:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Nein, unser heutiger Song des Tages ist kein Iron Maiden-Cover! Zugegeben, die Jungfrauen haben sicherlich die bekannteste Nummer (fast genau) dieses Namens veröffentlicht, doch zeitlich kamen ihnen die Schweden von Axewitch mit dem Titel um ganze zwölf Jahre zuvor. Dieses Quintett gründete sich 1981 in Linköping im Zuge des allgemeinen Aufschwungs der schwedischen Heavy Metal-Szene in diesen Jahren. In derselben gehörten Axewitch sicherlich nicht zu den unfähigsten Vertretern, wie sie erstmals im Folgejahr unter Beweis stellen konnten, als ihre EP "Pray For Metal" erschien. Das Scheibchen brachte den Newcomern einen Plattenvertrag mit dem Label Fingerprint Records ein. Die waren fast ausschließlich in Schweden tätig und vertrieben später auch die im Traditional Thursday bereits vertretenen Gotham City und gaben immerhin auch die erste Pretty Maids-EP heraus.
Axewitch veröffentlichten bei diesem Label 1983 ihren ersten Longplayer "The Lord Of Flies", der musikalisch durchaus zu überzeugen wusste. Zwar kann man durchaus nicht behaupten, dass die Scheibe dem Genre irgendetwas Herausragend-Neues oder Ungewöhnliches verliehe, doch zeigten einige Momente der Platte durchaus die höheren Ambitionen der Band deutlich an - darunter nicht zuletzt die ungewöhnlichen Harmonien und intelligenten Übergänge des hier vorgestellten Titelsongs. Und Axewitch blieben nicht untätig; ein Jahr nach dem Debut erschien "Visions Of The Past" (gut!) und ein Jahr darauf "Hooked On High Heels" (lahm!). Erst danach ging Axewitch langsam die Puste aus. Die Bandmitglieder konzentrierten sich zunehmend auf ihr eher Richtung Hard Rock orientiertes Nebenprojekt Hazy, was für Axewitch das langsame Ende zur Folge gehabt zu haben scheint. Unter dem Hazy-Banner erschienen allerdings auch nurmehr zwei EPs, ehe dann auch diese Inkarnation der Band sich von der Bildfläche verabschiedete. Zumindest bis 2007, denn seither sind Axewitch wieder unterwegs und haben vor zwei Jahren sogar ein neues Album mit dem Titel "Out Of The Ashes Into The Fire" herausgebracht. Die Scheibe klang tatsächlich erstaunlich gut, was daran liegen mag, dass es sich hier nicht - wie sonst oft bei reformierten Achtziger-Truppen der Fall - um einen seelenlosen Cash-Grab handelt, sondern immerhin vier Fünftel der klassischen Besetzung wieder mit am Start sind. Vor diesem Hintergrunde kann man Axewitch jede weitere Bekanntheit eigentlich nur gönnen!
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Okay, der Reihe nach: Eigentlich hatte ich vorgehabt, beim nächsten durch mich zu erstellenden Kotzer der Woche (mal wieder) Lordi zu behandeln. Die haben nämlich, nachdem sie zuerst mit der Leadsingle "Lucyfer Prime Evil" durchaus Lust auf ihr kommendes Album "Screem Writers’ Guild" gemacht hatten, mit "Thing In The Cage" einen echten Bauchplatscher hingelegt. Aber dazu demnächst einmal mehr. Kurz nach Lordi kamen nämlich Majesty und warfen meine Kotzer-Planung umgehend wieder über den Haufen. Auch die tauberfränkischen True Metaller veröffentlichen demnächst mal wieder eine neue Platte, die auf den Titel "Back To Attack" hören wird. Diese Namensgebung ließ nach den als "enttäuschend" noch zurückhaltend betitelten letzten Alben der Band aufhorchen und als dann als Leadsingle der Titelsong ausgekoppelt wurde und ein richtig veritables Brett darstellte, machte sich beim Schreiber dieser Zeilen tatsächlich so etwas wie Optimismus breit, dass Totgesagte ja vielleicht tatsächlich länger leben und Majesty in Comeback gelingen könnte. Tja, und dann kam "Freedom Child".
Mit dank Synthesizer-Einsatz ungenießbaren Strophen und einem Volksfest-Refrain, den Sabaton nicht belangloser hätten schreiben können, macht die neue Single genau da weiter, wo "Rebels" und "Legends" aufgehört hatten. Dieses nach Schema F gestrickte, radiofreundliche Plastiknümmerchen ist zu keinem Zeitpunkt auch nur vage interessant und dümpelt fast (aber nur fast) durch dieselben Sphären der Inspirationslosigkeit wie es Majestys vormals großen Idole von Manowar aktuell wieder tun.
Wer sich übrigens eine ganz besondere Ladung Fremdscham geben möchte, der möge bis ans Ende dieses Beitrags hinunterscrollen, denn unterhalb der eigentlichen Audio-Fassung von "Freedom Child" habe ich noch das offizielle Video der Single verlinkt, in welchem sich die Band noch einmal in bemerkenswerter Weise blamiert. Dass man es als Musikinterpret, also gewissermaßen als Star seines eigenen Videos, schaffen könnte, einen Clip aufzunehmen, der quasi die Definition des Begriffes "Simp" darstellt, hätte ich mir nicht ausmalen können, ehe ich es selbst gesehen habe. Die Band ist zu keinem Zeitpunkt mehr als schmückendes Beiwerk, während die eigentliche Handlung eine Schmalz-Ode an die Gamergirls darstellt und wir nebenbei noch erfahren, dass Gaming offenbar gegen Akne hilft (Man lernt nie aus!). Andererseits, vielleicht ist diese Fokussetzung mit Blick auf das unbeholfene Gehopse von MS Maghary in diesem Video sogar zu rechtfertigen...
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Zur Abwechslung gibt es heute mal wieder etwas eher Munteres auf die Ohren zu unserem Traditional Thursday. Dass der Verfasser dieser Zeilen ein gewisses Faible für die kanadische Metalszene hat, dürfte dem gewissenhaften Leser dieser Kategorie nicht verborgen geblieben sein. Aus dem zweitgrößten Flächenstaat unseres Planeten kommt oder kam eine ganze Reihe von hochklassigen Musikacts, die leider oftmals etwas weniger Aufmerksamkeit erhalten als ihre südlichen Nachbarn aus den US of A. Zu den eher im Untergrund verhafteten Künstlern des Landes gehören dabei sicherlich nicht zuletzt Strike Force - nicht zu verwechseln mit ihren Landsmännern von Striker, dem Heavy Metal-Nachwuchs jüngerer Generation, der in den letzten Jahren eher als verkappte Poprock-Gruppe von sich reden machte.
Nein, Strike Force gründeten sich bereits 1982 in Montreal, waren aber - hier treffen sie sich gewissermaßen mit jüngeren Striker - einer eher soften Spielweise des Heavy Metal verpflichtet, wovon ihr selbstbetiteltes Album "Strike Force" von 1984, zusammen mit den beiden Singles "Shadow Of The Night" und "She’s A Killer" die einzige musikalische Hinterlassenschaft der Herrschaften aus Quebec, Zeugnis ablegt. Insgesamt ist die benannte Scheibe kein musikalischer Meilenstein, aber eine durchaus eine unterhaltsame Angelegenheit. Der unter den Fittichen des Mini-Labels Globe erschienene Longplayer ist recht glatt produziert, Sänger und Bassist Mario LeBlanc verfügt über ein unauffälliges, in mittleren Tonhöhen angesiedeltes Organ; abgerundet wird die Angelegenheit durch einige, dankenswerterweise meist eher sparsam eingesetzte, Keyboards. Die Scheibe ist generell dann am stärksten, wenn sie ein wenig Fahrt aufnimmt, was beispielsweise beim heute vorgestellten "Devil’s Daughter", einem echten Gute-Laune-Stück, der Fall ist. Leider brach die Band nach dem Erscheinen des Albums weitgehend auseinander. Drummer Peter Paillé verstarb noch 1984 in Leukämie, außerdem suchte Gitarrist Romy Bélanger das Weite. Er wurde durch Marc Tousignan ersetzt, der jedoch seinerseits bald darauf seinen Hut nahm. Zwar schusterten die verbleibenden Mitglieder in der Folge tatsächlich noch einmal ein Line-up zusammen und ergänzten sich mit der Hereinnahme von Sänger Miguel Garcia gar zum Quintett, wodurch sich Mario auf das Bassspiel fokussieren konnte, doch letztlich war 1987 der Ofen endgültig aus und Strike Force verschwanden für immer von der Bildfläche. Obwohl "Strike Force" nie in größerem Maße promoted wurde und bis heute auch keine Neuauflage (beispielsweise auf CD) erfolgt ist, wird die Platte zu gar nicht übertrieben hohen Preisen gehandelt und scheint zumindest in Kanada recht gut erhältlich zu sein. Für Fans etwas gediegenen Heavy Metals kann es sich lohnen, die Augen offen zu halten!
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.