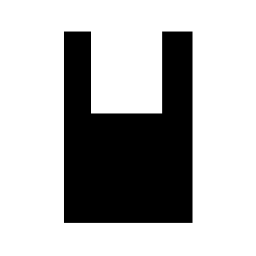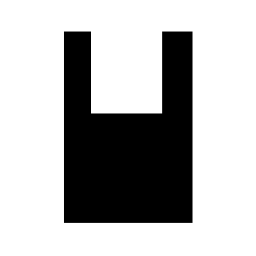Review: Accept - Too Mean To Die:
Sie gelten als die deutsche Metal-Institution schlechthin: Accept haben am Freitag ihr neues Album "Too Mean To Die" auf den Markt geworfen, bereits Longplayer Nummer sechzehn für die Dauerbrenner; vier Jahre hat man sich Zeit gelassen nach dem letzten Werk "The Rise Of Chaos", was den längsten zeitlichen Abstand zwischen zwei Alben der Band markiert, wenn man mal die beiden Phasen ausnimmt, in denen sich die Gruppe zwischenzeitlich aufgelöst hatte. In dieser Zeit des Wartens gab es auch einige personelle Wechsel bei den Solingern zu verzeichnen, so ersetzte Martin Motnik das abgewanderte Bass-Urgestein Peter Baltes und mit Philip Shouse holte sich die Gruppe einen dritten Gitarristen an Bord - eine Methode, mit der es ja bereits vor Langem auch Iron Maiden schon geschafft hatten, ihre Besetzung unnötig aufzublähen, ohne in Sachen Sound irgendeinen Effekt zu erzielen. Aber wer weiß, vielleicht wird ja bei Accept auch alles anders und die Neuen bringen tatsächlich wertvolle Impulse für das vorliegende Album?
Dieser Eindruck drängt sich zumindest beim eröffnenden "Zombie Apocalypse" nicht wirklich auf. Die Nummer beginnt atmosphärisch und geht dann über in einen eher durchschnittlichen Accept-Midtempo-Rocker. Das ist nun an sich nichts schlechtes und die Einzelmusiker beweisen hier durchaus ihre Klasse - Mark Tornillo ist nach wie vor sehr gut bei Stimme, Christopher Williams liefert an den Drums ganze Arbeit ab und über die Klasse von Wolf Hoffmann an der Gitarre muss man ohnehin keine Worte verlieren -, doch wirkt die Nummer eher wie ein Song, den man im weiteren Verlauf eines Albums ansiedeln könnte, während er als Opener seltsam mutlos gewählt erscheint. Alle Alben-Opener der Band seit "Blood Of The Nations" waren kraftvoll nach vorne preschende Songs, sodass man für "Too Mean To Die" durchaus einen ähnlich zupackenden Einstieg hätte erwarten können. Naja, Schwamm drüber, nichtsdestotrotz ist die Nummer für sich gesehen natürlich ein gutklassiger Track - wenn nur nicht das Problem mit den Lyrics wäre. Sich über die heutige digitale Generation zu mokieren, ist nun generell nicht eben eine innovative Meisterleistung, aber wer einen Text mit dieser Thematik schreibt und den entsprechenden Song dann aber groß mit YouTube-Video über Social Media bewirbt, der muss sich schon fragen lassen, ob er sich eigentlich überhaupt noch selbst reflektiert.
Aber gut, wollen wir diese lyrische Unsicherheit einmal nicht zu hoch hängen und machen stattdessen weiter mit dem Titeltrack, der auch in musikalischer Hinsicht deutlich besser zu gefallen weiß. Was man eigentlich als Opener erwartet hätte, bekommt man mit "Too Mean To Die" nun nachgereicht; peitschendes Riffing bei deutlich erhöhter Schlagzahl und natürlich Gitarrenakrobatik zu genüge. Von allen drei Singles, die man aus "Too Mean To Die" vorab zu hören bekam, ist dieser Song mit Abstand der stärkste.
Anders liegt die Sache allerdings schon wieder beim nachfolgenden "Overnight Sensation". Der Song hängt extrem an seinem Mitsing-Refrain, der auch, so vorhersehbar er auch klingen mag, tatsächlich überzeugen kann. Der Rest des Tracks ist allerdings absolut nach Schema F gestrickt und weist keinerlei Wiedererkennungswert auf. Dazu kommt einmal mehr ein geradezu hanebüchener Text (diesmal geht es um Influencer). Man fragt sich beim Genuss des Stückes ernsthaft, ob Accept sich hier an "Comedy-Metal" versuchen, oder ob sie einfach textlich vollends zu einer Karikatur ihrer selbst verkommen sind. Sicher, eigentlich soll an dieser Stelle "Too Mean To Die" als musikalisches Werk untersucht werden, aber hier sind die lyrischen Unfälle einfach derart präsent, dass sie den Hörgenuss schmälern.
Von einer deutlich besseren Seite zeigt sich da schon wieder "No One's Master". Der Track steht typisch für jenen Stil, für den man Accept kennt und liebt; schwungvoll geht es nach vorne, doch wird gleichzeitig auch eine Extra-Dosis Melodiösität integriert, was sich besonders im harmonisch-angenehmen Gitarrenspiel niederschlägt. Auch Marks rauer Gesang fügt sich in diese Mischung hervorragend ein und macht die Nummer zu einem Highlight des Albums.
Doch die Achterbahn, die "Too Mean To Die" bislang darstellt, sie fährt weiter und so kommt nach einem Hoch unvermeidlicherweise wieder ein Tief. Dieses hier trägt den Namen "The Undertaker" und stellte auch das Erste dar, was man von dem neuen Album überhaupt zu hören bekam. Der Song versucht, düster und atmosphärisch zu sein und steht damit ein Wenig in der Tradition von "Shadow Soldiers" von der "Stalingrad"-Scheibe, der ähnlich mau war, aber zumindest textlich voll zu überzeugen wusste. "The Undertaker" dagegen verliert sich in jeder Hinsicht im Mittelmaß und das lahme Video, mit dem der Song veröffentlicht wurde (inklusive völlig beliebigen Joker-Verschnitts), machte die Sache auch nicht besser.
Auf "Sucks To Be You" wird dagegen wieder ordentlich gerockt - sehr zur Freude des Hörers! Zwar lässt sich nicht leugnen, dass man Midtempo-Stampfer wie diese recht groovige Darbietung von Accept schon mehr als einmal zu Ohren bekommen hat, doch ist es ja gerade das, was man als Fan der Band hören möchte, und letztlich kann man nur konstatieren, dass die einwandfrei vorgetragene Nummer auch gehobene Erwartungen nur erfüllt. Vielleicht lässt sich sogar sagen, dass "Sucks To Be You" in gewisser Hinsicht das ist, was "Zombie Apocalypse" hätte sein können, wenn man dem letzteren Song nicht die Eröffnung des Albums aufgebürdet hätte, für die dieser schlichtweg nicht gemacht ist.
Auch "Symphony Of Pain" verfügt über ein starkes Mainriff und lässt sich zunächst als weiterer Rocker der ersten Güteklasse an; leider fällt das Niveau im weiteren Verlauf etwas ab, denn wie man es bei einem Track mit diesem Titel schon erwarten konnte, sind die Klassik-Anleihen natürlich nicht fern. Glücklicherweise haben Accept auf dem neuen Album sämtliche Geigen zu Hause gelassen (nach der "Symphonic Terror"-Livescheibe musste einem diesbezüglich ja schon das Schlimmste schwanen), sondern bauen stattdessen auf Wolfs Gitarrenarbeit, der virtuos Beethoven zitiert. Nun sind solche Klassik-Anspielungen im musikalischen Fundus des Meister Hoffmann ja keineswegs eine Neuheit und grundsätzlich auch immer gerne gesehen - sein Interludium während "Metal Heart" gilt nicht umsonst als eines der ikonischsten Heavy Metal-Soli aller Zeiten und "Final Journey" vom "Blind Rage"-Album kann mit seinen Klassik-Zitaten ohne weiteres als einer der, wenn nicht gar der beste Accept-Song nach der Jahrtausendwende bezeichnet werden. Doch bei "Symphony Of Pain" wirkt leider alles ein Wenig gezwungen, so als habe man unbedingt einen Song mit Klassik-Anstrich schreiben wollen und diese Nummer dann halt danach ausgerichtet, anstatt dass entsprechende Anleihen sich wirklich organisch in den Track eingefügt hätten.
Über den nachfolgenden Song ist aber auch "Symphony Of Pain" noch deutlich erhaben: "The Best Is Yet To Come" - und man kann nur hoffen, dass der Song-Titel sich bewahrheitet, denn der vorliegende Track selbst fällt als Highlight mal zügig aus. Accept versuchen sich an einer Ballade, was sie ja auch in der Vergangenheit mit wechselndem Erfolg gerne mal getan haben, doch ist "The Best Is Yet To Come" keine düster-depressive Nummer, sondern wartet mit zuckersüßen Melodieführungen auf, bei denen man sich fragt, ob nicht zufällig Florian Silbereisen als Co-Songwriter engagiert wurde. Hier gibt es wirklich nichts zu beschönigen und nichts zu retten - ach ja, und wurde schon erwähnt, dass sich auch die textliche Darbietung auf "Too Mean To Die" bestenfalls durchwachsen anlässt?
Auch das hierauf folgende folgende "How Do We Sleep" taugt leider nicht, die beim vorangegangenen Song Eingeschlafenen wieder aufzuwecken. Die Nummer selbst ist zwar weder eine Ballade noch qualitativ groß zu bekritteln, doch mangelt es dem sehr hymnenhaften Track einfach an der nötigen Power, um das Album wieder in die Spur zu bringen. Vielleicht hätte der Song eher überzeugt, wenn er an anderer Stelle in der Tracklist gestanden hätte, so stellt er eher nur Mittelmaß dar.
Immerhin, "Not My Problem", der letzte vollwertige Song des Albums, legt noch mal ein Pfund nach, das man sich eigentlich viel früher schon zu hören gewünscht hätte. Hier geht es nochmal richtig zur Sache, Accept schießen aus allen Rohren, vergessen darüber aber nicht einen mächtigen, eingängigen Refrain, der gleichsam als Kontrapunkt für die sonstige Energieleistung dient. Stark!
Anschließend schließt "Too Mean To Die" mit dem Instrumental-Stück "Samson And Delilah". Und ja, sicher werden an dieser Stelle wieder Viele "Egozentrismus!" schreien, doch ausnahmsweise müssen Accept hier einmal in Schutz genommen werden. Denn was man von Wolf Hoffmann persönlich auch halten mag (zu den sympathischsten Figuren des Metal-Circus' wird ihn wohl kaum jemand zählen), so muss man doch festhalten, dass seine Solo-Orgien schon immer Bestandteil der Darbietungen Accepts waren und auch ausnahmslos überzeugen konnten, und "Samson And Delilah" macht diesbezüglich keine Ausnahme von der Regel. Der in ungewöhnlichen Harmonien arbeitende, klassisch angehauchte Song ist technisch auf absolutem Weltklasse-Niveau angesiedelt und kann mit Fug und Recht als ein Höhepunkt des Albums bezeichnet werden.
Fazit:
Und so schleppen also die abschließenden beiden Highlights eine Scheibe noch über die Ziellinie, das man fast schon verloren glaubte. Trotzdem: Ein musikalisches Filetstück stellt "Too Mean To Die" nicht dar. Zwar sind die Songs alle rein technisch einwandfrei konzipiert und vorgetragen, doch kann man von einer Band wie Accept mehr erwarten als das und so scheitert die Formation vielleicht letzten Endes auch an ihrem selbst etablierten Anspruch. Nicht umsonst hat die Teutonen-Stahlschmiede nach ihrer Rückkehr mit "Blood Of The Nations", "Stalingrad" und "Blind Rage" drei moderne Klassiker in Stein gemeißelt, die einfach kaum zu erreichen sind und denen man schon mit dem "nur" guten "The Rise Of Chaos" kaum noch gerecht wurde. "Too Mean To Die" setzt nun leider diesen Abwärtstrend unvermindert fort, womit sich die Exil-Rheinländer bei aller technischen Finesse endgültig im Mittelmaß wiederfinden. Man wäre versucht, eine Parallele zu Kreator zu ziehen, dem anderen großen deutschen Metal-Schlachtschiff, das nach den Meisterwerken der Nuller-Jahre zuletzt ebenfalls einen erschreckenden Formverlust zu verzeichnen hatte. Doch diese Geschichte soll einmal in einem anderen Review weitergeschrieben werden...
ANSPIELTIPP: